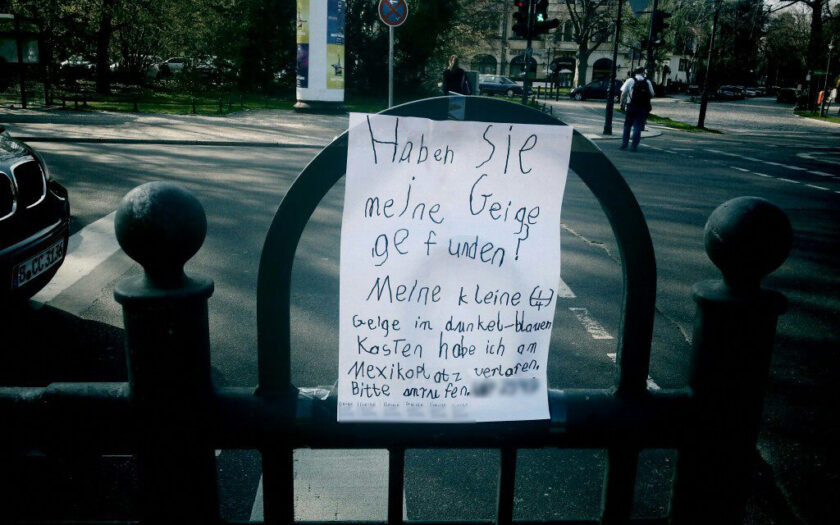Das Supermaschinen-Problem
„Ein Computer kann alles, aber sonst nichts“, so das „Lexikon der Postmoderne“ von 1988 lakonisch.
[2018] John von Neumann schrieb einmal: „lebende Organismen sind so gebaut, daß Fehler möglichst unauffällig und harmlos werden; künstliche Automaten dagegen sind so entworfen, daß Fehler möglichst auffallend und verheerend werden.“
Eine geniale Idee, man entwickelt Lösungen für Probleme, die man mitproduziert für die man dann Lösungen erfindet, die die neuen Probleme lösen.
GEMA-Vorstand und Aufsichtsräte als aktive Hampelmänner und -frauen?
Dass man draußen gerade bei den Befürwortern einer Reform der Kulturförderung der GEMA das Thema auf einen Streit über die Sinnhaftigkeit der Unterscheidung von E- und U-Musik projiziert, ist, siehe unten das Statement des Ensemble Recherche, kein Zufall. Dabei werden ja nicht musikgeschichtlich-ästhetische Fragen beantwortet oder gelöst, sondern der Ablenkungsversuch gestartet, möglichst viele Personen mit Kleinstförderungen zu bedenken, die niemandem ganz nichts mehr helfen, siehe Statements von Sebastian Gramss und Hans Lüdemann (auch unten). Am heutigen Tag entscheidet sich in München, ob die GEMA ihr Gehirn an der Garderobe der Industrie abgibt.

Dabei wäre das Problem, zack, gelöscht, wenn man den Anteil der Kulturförderung einfach erhöhen würde, das Geld ist ja ohnehin da, und neben der bisherigen Kulturförderungspraxis weitere Stand- und Spielbeine einziehen wollte. Aber wären dazu diejenigen bereit, die bereits jetzt extreme Tantiemenzahlungen von der GEMA erhalten, die meistens aus dem Bereich der U-Musik stammen? So aus Solidarität zu sich selbst?
Das wird nicht passieren, denn man steht auch im Musikbereich streng genommen im Wettbewerb. Solidarität ist da nicht so leicht zu mobilisieren, schon gar nicht im Bereich der U-Musik. Und so sind es nach wie vor vor allem die Urheber:innen aus dem Bereich der E-Musik, die überhaupt Vorschläge machen, wie man dem ohnehin existierenden ästhetischen Wischiwaschi gerecht werden könnte.
Ensemble Recherche zur GEMA-Reform
Das Problem mit der Diskussion um die GEMA-Reform ist, dass sie oft als eine Art Kulturkampf zwischen E-Musiker*innen und U-Musiker*innen geframed wird. In Gesprächen mit Komponist*innen, mit denen wir als Ensemble arbeiten, zeigt sich aber deutlich: Die klare Trennung zwischen E- und U-Musik ist in der Neuen Musik längst überholt. Wir bevorzugen eine durchlässige Musik, die sich bewusst jeder Kategorisierung entzieht.
Das wahre Problem liegt also nicht in einer ästhetischen Auseinandersetzung, sondern in den finanziellen Folgen dieser Reform. Denn mit der geplanten Abschaffung der E-/U-Klassifizierung geht auch ein tiefgreifender Umbau der Verteilungssystematik einher: Statt wie bisher auch kulturpolitisch zu gewichten, sollen künftig ausschließlich marktwirtschaftliche Kriterien gelten – etwa Reichweite und Nutzung.
Gerade Komponist*innen zeitgenössischer Musik, die meist in der freien Szene tätig sind, wären davon massiv betroffen. Nach Einschätzung des Verbands FREO drohen hier Einbußen von bis zu 90 %.
Wir können und wollen diese Entwicklung nicht unkommentiert hinnehmen. Denn sie stärkt das kommerzielle Musikbusiness – und schwächt die freie Szene. Deshalb solidarisieren wir uns mit all den Komponist*innen, die sich gegen diese Reform aussprechen. Es braucht keine nivellierende Vereinfachung, sondern gerechte, vielfältige und zukunftsfähige Strukturen für Musik aller Formen. (via Facebook)
Neue Antwort zu Fragen zur GEMA-Reform von Sebastian Gramss und Hans Lüdemann
Wenn der Antrag 22a des Vorstands und Aufsichtsrats der GEMA auf der Mitgliederversammlung eine Mehrheit findet: Welche Autor:innen werden Ihrer Ansicht nach begünstigt, welche benachteiligt? Wer sind die Gewinner, wer die Verlierer dieser GEMA-Kulturreform?
Wer konkret begünstigt werden soll, bleibt unklar und wirkt unausgereift. Der Vorschlag ist zudem deutlich zu kurzfristig angesetzt.
Sicher ist hingegen: Es wird zahlreiche Verlierer geben. Insbesondere Urheber:innen im Bereich der sogenannten E-Musik sowie in den Zwischenbereichen – also Musikformen, die weder eindeutig der E- noch der U-Kategorie zugeordnet werden können – zählen klar zu den Verlierern.
- Die neuen Regelungen sind deutlich schlechter und außerdem unklar formuliert.
- Musik kleinerer Szenen oder sogenannter Minderheitenmusik wird dadurch erheblich benachteiligt.
- Der angestrebte Ausgleich über das Kulturförderprogramm KUK erscheint fragwürdig.
Fest steht: Die Reform schadet vielen und nützt vermutlich nur wenigen.
Welche gesellschafts- und kulturpolitischen Folgen für das Musikleben (Konzertvielfalt, Veranstalter-Engagement, Ausbildung) erwarten Sie als Folge der sogenannten „Kulturreform“ der GEMA?
Ein verheerendes Signal – und das zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt.
Wirtschaftlichkeit rückt in den Vordergrund, der Fördergedanke wird ausgehöhlt – und das in einer Phase, in der Kunst und Kultur ohnehin unter großem Druck stehen.Die Sorge: Die GEMA orientiert sich zunehmend an wirtschaftlichem Erfolg und Umsatzzahlen. Musik, die keinen kommerziellen Erfolg verspricht, könnte künftig nicht mehr gefördert werden.
Zudem ist die geplante KUK-Einstufung für Veranstaltungen völlig unpraktikabel: Für jedes einzelne Konzert müsste ein Antrag gestellt werden. Das ist organisatorisch kaum umsetzbar. Hinzu kommt: Die zuständigen Gremien arbeiten zu langsam (siehe z. B. Werkausschuss).
> Die neue Regelung bedeutet eine Bedrohung und Verunsicherung kleinerer Veranstalter, die für die nicht – kommerziellen Randbereiche des Musikbetriebs besonders wichtig sind.
Zitat: „Die Zuordnung erfolgt veranstaltungsbezogen und nicht werkbezogen.“
— Wer entscheidet das? Und wann?
Welche konkreten Auswirkungen der GEMA-Kulturreform befürchten Sie für sich persönlich?
Sebastian G.: Voraussichtlich werden 50–60 % meiner Jahreseinnahmen wegfallen.
Hans L..: Die Auswirkungen wären erheblich – im schlimmsten Fall existenzbedrohend.Der Wegfall der bisherigen Förderstruktur betrifft nicht nur uns als Einzelpersonen, sondern auch jede Form musikalischer Forschung.
Früher bedeutete GEMA-Honorierung auch eine Ermutigung zur Innovation – eine Form der indirekten Förderung künstlerischer Arbeit.
Ohne diese Anerkennung des nicht-kommerziellen künstlerischen Schaffens ändert sich die Grundlage für freies künstlerisches Denken und Handeln radikal.Welche Auswirkungen erwarten Sie für Organisationen wie den Deutschen Komponist:innenverband und die GEMA selbst?
Das Image der GEMA leidet – erneut ein fatales Signal zum falschen Zeitpunkt.
Statt Förderung rückt Kommerzialisierung in den Vordergrund.
Das kunstfördernde, historisch einmalige Profil der GEMA steht auf dem SpielKöln, am 7.5. 25
Weitere Antworten und Statements von Johannes K. Hildebrandt, Mathias Lehmann, Camille van Lunen, Felix Janosa, Sabine Kemna, Ludwig Wright, Claus-Steffen Mahnkopf, Sebastián Gramss & Hans Lüdemann in der nmz (neue musikzeitung)